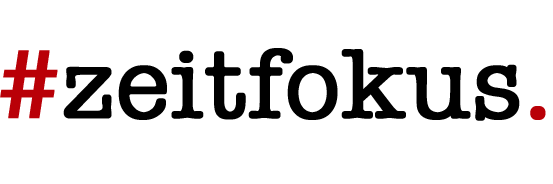Weiter im Kampf gegen Ebola
Im liberianischen Monrovia betreibt das Deutsche Rote Kreuz mit Unterstützung der Bundeswehr im Kampf gegen Ebola eine Behandlungseinrichtung. Zunächst war sie als "Ebola Treatment Unit" (ETU) aufgebaut und wurde nach sinkenden Fallzahlen in eine "Severe Infection Temporary Treatment Unit" (SITTU) weiter entwickelt. Hier geht es insbesondere darum, die letzten Ebola-Fälle in der Region auszufiltern, um der Epidemie endgültig Einhalt zu gebieten.

Im liberianischen Monrovia betreibt das Deutsche Rote Kreuz mit Unterstützung der Bundeswehr im Kampf gegen Ebola eine Behandlungseinrichtung. Zunächst war sie als "Ebola Treatment Unit" (ETU) aufgebaut und wurde nach sinkenden Fallzahlen in eine "Severe Infection Temporary Treatment Unit" (SITTU) weiter entwickelt. Hier geht es insbesondere darum, die letzten Ebola-Fälle in der Region auszufiltern, um der Epidemie endgültig Einhalt zu gebieten.
Im Kampf gegen Ebola in Liberia geht es neben der Therapie der bereits erkrankten Patienten vor allem um die Vermeidung der Ausbreitung der Erkrankung durch eine Mensch-zu-Mensch Übertragung. Im Anfangsstadium dieser Erkrankung präsentieren sich die Patienten mit Symptomen wie Fieber, Kopfschmerzen und Durchfall. Diese klinischen Symptome ähneln dabei anderen Infektionskrankheiten. Eine Unterscheidung von Ebola zu diesen Infektionskrankheiten (vor allem Malaria, aber auch Tuberkulose, HIV o.ä.) ist nur durch eine spezifische Labormethode möglich.
Im 4. Quartal 2014 litt der überwiegende Anteil an Patienten mit diesen Symptomen an Ebola, daher musste die Untersuchung und Behandlung in einer sogenannten Ebola Treatment Unit (ETU) durchgeführt werden. Mit Beginn 2015 hat der Anteil der Ebola-Infizierten an der Anzahl der hochfieberhaft Erkrankten deutlich abgenommen, sodass nunmehr andere Infektionserkrankungen in den Vordergrund gerückt sind. Hier steht vor allem die frühzeitige Trennung von Ebolafällen zu anderen Patienten im Fokus. Hierzu waren Änderungen in den Verfahrensabläufen der Behandlungseinrichtung sowie eine Erweiterung des Spektrums der Labordiagnostik erforderlich.
Dieses erfolgt nunmehr als Pilotprojekt in der DEU SITTU, die aus der ehemaligen ETU entstanden ist. Nach einer ersten Trennung der Patienten anhand der klinischen Symptomkonstellation wird der labortechnische Nachweis durchgeführt. Patienten mit nachgewiesener Ebola Infektion werden weiterhin in einer nahegelegenen ETU aufgenommen. Die Behandlung der übrigen Nicht-Ebola-Patienten erfolgt dann in einer geeigneten Behandlungseinrichtung.
Mit dieser Umstellung der Verfahrensweise sind drei wesentliche Ziele erreicht worden. Erstens wird das Risiko einer Weiterübertragung von Ebola durch frühzeitige Trennung der Patientengruppen vermindert. Zweitens sind die Akzeptanz in der einheimischen Bevölkerung und die Bereitschaft, sich zur Untersuchung in eine solche Einrichtung ohne massive Ebola-Gefährdung zu begeben, deutlich angestiegen. Und drittens steigt mit dieser Akzeptanz auch die Chance, die noch verbliebenen Ebola-Infizierten frühzeitig zu erkennen und damit die "letzte Meile" in der Bekämpfung dieser Erkrankung schaffen zu können.
Seit Eröffnung der SITTU am 21. Januar 2015 gab es bisher 170 Patienten, die in der Einrichtung Hilfe suchten. 42 wurden daraufhin stationär aufgenommen, Tendenz steigend. "Heute haben wir 18 Patienten in unserer Einrichtung", erklärt Oberstabsarzt Dr. Robert P. Er ist Senior Medical Officer und für die Daten aus der SITTU verantwortlich, die er täglich an das Gesundheitsministerium weiterleitet. "Der Pflegeaufwand ist hier so hoch, dass wir um ein Vielfaches mehr Personal brauchen als für einen normalen Patienten in einem deutschen Krankenhaus." Um die Kapazitäten zu erhöhen werden derzeit weitere einheimische Pflegekräfte ausgebildet.
Alles in der Triage passiert auf Abstand, damit Ebola nicht übertragen werden kann. Der Patient misst sich Fieber und füllt mit dem Arzt einen Anamnesebogen aus. Wenn es sich bei den Symptomen um Ebola handeln könnte, wird der Patient in das "Suspect-Zelt", also das Verdachtszelt, geführt und isoliert von anderen Verdachtsfällen untergebracht, um einen Kontakt auszuschließen.
Dort wird eine Blutuntersuchung durchgeführt. Der Nachweis erfolgt über eine polymerase Kettenreaktion (PCR) in einem Labor der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ist der Patient tatsächlich positiv auf Ebola getestet, wird er an die benachbarte ETU zur weiteren Behandlung übergeben. Ist der erste Test negativ, wird er in das zweite Zelt, das sogenannte Unlikely-Zelt, verlegt. Also in das Zelt, in dem es unwahrscheinlich ist, dass sich Ebola Patienten darin befinden.
Hier erfolgt die zweite Blutuntersuchung auf Ebola nach weiteren 72 Stunden. Ist das Ergebnis positiv, wird der Patient an die benachbarte ETU übergeben. Ist auch dieser Test negativ, wird der Patient in das dritte Zelt, das Confirmed-Negative-Zelt verbracht. Die Patienten im dritten Zelt haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Ebola. Wird der Patient entlassen, geht er durch die "Happy Shower". Alles, was er bei sich hatte, bleibt hier und er erhält neue Kleidung. Aber es gibt leider auch den Fall, dass es ein Patient nicht schafft und stirbt.
Die größte Herausforderung besteht darin, dass sich das Personal vor einer Ansteckung schützen muss. Daher tragen alle, die in einer bestimmten Zone arbeiten, eine persönliche Schutzausstattung (Personal Protective Equipement, kurz PPE). Dabei werden eine High-Risk-Zone und eine Risk-Zone unterschieden. In der High-Risk-Zone werden Ebola-Patienten vermutet (Triage, Zelt 1 und 2), in der Risk-Zone "nur" Patienten mit anderen ernsthaften Infektionskrankheiten.
Für die Serviceleistung im Umgang mit der PPE und dem Reinigen und Desinfizieren der Behandlungsplätze sowie dem Umgang mit Leichen ist die Teileinheit Infection Prevention and Control (IPC) verantwortlich. Stabsfeldwebel Dirk A. ist hier als sogenannter Expat tätig. So wird eine Fachkraft benannt, die nicht aus dem eigenen Land stammt. IPC ist die größte Teileinheit der SITTU mit derzeit 84 liberianischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Anzahl wird in nächster Zeit auf 108 steigen. Die Aufgabe von IPC ist es, vor Infektionskrankheiten durch Reinigung zu schützen.
Der 45-Jährige, weist die jeweiligen Schichtführer, die sogenannten Supervisor, an. Gearbeitet wird in vier Schichten rund um die Uhr. "Die Zusammenarbeit läuft sehr gut und wir fangen gerade an, mehr Aufgaben an die Einheimischen abzugeben." Eine Supervisorin soll im weiteren Verlauf zur Expertin ausgebildet werden. Damit wird der Übergang ohne Beteiligung der Bundeswehr vorbereitet.
"Wir haben täglich wiederkehrende Arbeiten" erklärt Stabsfeldwebel Dirk A., "zum Beispiel in der "red Zone", Müll entsorgen oder Exkremente wegwischen und desinfizieren." Zudem ist sein Team für das Müllmanagement verantwortlich und entsorgt den kontaminierten Müll aus der "red Zone" und auch den Müll aus der "green Zone". Sie führen darüber hinaus das sogenannte Dead-Body-Management durch. Das bedeutet, dass die Leiche dekontaminiert werden muss und für eine Beerdigung vorbereitet wird. Danach muss die gesamte Umgebung desinfiziert werden.
Erst ein Gebet, dann einen Saft
"Es gibt auch kleinere Sprachprobleme", schmunzelt Dirk A. "Wir können uns sehr gut auf Englisch verständigen, doch man muss sich erst ein bisschen in den Slang hier reinhören. So habe ich mich anfangs gefragt, was die Einheimischen unter Trash verstehen, bis mir klar wurde, dass sie die Triage meinen."
In den Umkleidebereichen zur "red"- und "green Zone" stehen große Schilder. Für Außenstehende nicht sofort verständlich und doch so einfach. "Donning" and "Doffing", das bedeutet so viel wie "Do on" und "Do off", erklärt der 45-Jährige. Hier übernehmen die Mitarbeiter des IPC die Hilfe beim Anziehen und später beim Desinfizieren und Ablegen der Schutzkleidung. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weil dies ein sehr kritischer Punkt ist. Unterlaufen hier Fehler, kann das schwerwiegende Folgen haben.
Stabsfeldwebel Dirk A. ist sehr zufrieden mit den Leistungen der Einheimischen. "Die Mentalität ist hier eine ganz andere. Die Menschen haben Zeit und lassen sich Zeit und trotzdem funktioniert es." Zu Beginn der Schicht singen die Angestellten gerne ein Lied und haben den Deutschen auch schon mal gefragt, ob er nicht ein Gebet sprechen könne. "Ich habe daraufhin unseren Militärgeistlichen kontaktiert, er hat es einmal vorgemacht und mir ein paar Gebete überlassen und jetzt bin ich darauf vorbereitet."
Das Tragen des PPE ist extrem belastend. Der Wasserverlust durch Schwitzen ist äußerst extrem. "Nach dem Ablegen des PPE gibt es eine Art Saft, der hier wirklich sehr begehrt ist, um Elektrolyte und Zucker wieder zuzuführen."
"Man sieht den Menschen hier ihre Dankbarkeit an", erklärt der Experte für Desinfektion abschließend: "Und das gibt mir wiederum ein gutes und motivierendes Gefühl."