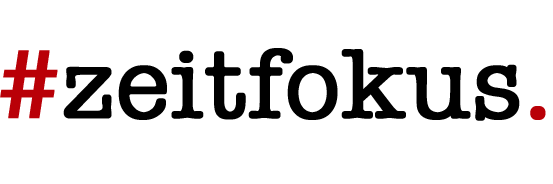Koalitionsverhandlungen oder Paartherapeuten
Eigentlich war das ungleiche Paar seit dem 24. September bereits geschieden, doch dann kam der nicht mehr ganz so frischen Braut der - beziehungsweise die - Partner für die neue Liaison abhanden. Also müssen es nun die alten Partner noch einmal miteinander versuchen. Wären Union und SPD Eheleute, wären sie ein Fall für Paartherapeuten.

Eigentlich war das ungleiche Paar seit dem 24. September bereits geschieden, doch dann kam der nicht mehr ganz so frischen Braut der - beziehungsweise die - Partner für die neue Liaison abhanden. Also müssen es nun die alten Partner noch einmal miteinander versuchen. Wären Union und SPD Eheleute, wären sie ein Fall für Paartherapeuten.
Doch im Fall der potenziellen Regierungsparteien geht es nicht um Probleme einer abgelebten Zweisamkeit, sondern um politische Verantwortung für ein 80-Millionen-Volk in der Mitte Europas. Persönliche Befindlichkeiten, kleinliche Parteitaktik und politische Eifersüchteleien müssen da zurückstehen. Müssten sie eigentlich. Gestern haben die Koalitionäre in spe noch einmal bis tief in die Nacht über die letzten Knackpunkte des politischen Ehevertrages gerungen. Was sich seit zwei Wochen in Berlin abspielt, ist der mühsame Kampf zweier - eigentlich gegensätzlicher - politischer Lager, die sich aus Mangel an vernünftigen Alternativen wieder zu einer Regierungs-Zweckgemeinschaft zusammen finden müssen. Weder haben sich CDU und CSU die Sozialdemokraten als Regierungspartner gewünscht. Erst Recht nicht war die SPD auf eine weitere Koalition mit Dauerkanzlerin Angela Merkel erpicht. Doch die Verhältnisse erzwingen nun geradezu etwas ganz anderes als eine Wunschkoalition.
Dabei scheinen Union und SPD derzeit offenbar nichts mehr zu fürchten, als dass der neuen Koalition der Stempel des "Weiter so" aufgedrückt werden könnte. Doch ein solches Etikett wäre voreilig. Es hält auch genauerer Betrachtung nicht stand. Zunächst einmal: Es wird keine Wiederholung der bisherigen Großen Koalition geben. Denn die verfügte im Bundestag über eine fast schon märchenhafte 80-Prozent-Mehrheit. Eine Koalition von Union und SPD von heute wäre schon rein zahlenmäßig gar keine "große" mehr. Der Vorsprung von Schwarz-Rot im gegenwärtigen Bundestag ist auf ein Maß zusammen geschrumpft, dass die Koalitionäre eher beunruhigen dürfte. All zu viele Abweichler in den eigenen Reihen darf es im Bundestag künftig nicht geben, sollte das Not-Bündnis nicht vor der Zeit platzen.
Um das zu verhindern, müssten mehr Verlässlichkeit sowie ein neuer Stil einziehen. Anders als vor vier Jahren, als Kanzlerin Angela Merkel auf dem Zenit ihrer Macht stand, gehen heute drei mehr oder weniger angeschlagene Parteien ein Bündnis ein. Merkel ist nicht nur wegen ihrer Flüchtlingspolitik bis tief ins Unionslager hinein umstritten. Die CSU befindet sich in einem Interregnum, einer Übergangsphase, in der Horst Seehofer noch viel, der designierte Landesvater Markus Söder, aber noch relativ wenig zu sagen hat. Und aus der Mini-Opposition ist eine vielstimmige, laute Kraft geworden, von ganz Rechts bis ganz Links.
Für die SPD wird die Frage - Regierungskoalition oder nicht? - zu einer Zerreißprobe, wie sie das seit den Hartz-Reformen nicht mehr erlebt hat. Anhänger und Befürworter stehen sich unversöhnlich gegenüber. Auffallend ist, dass die Partei nicht die in den Koalitionspapieren festgezurrten Erfolge würdigt, sondern über das Nicht-Erreichte genüsslich mäkelt. Offenbar interpretieren zahlreiche Genossen das Parteikürzel SPD als "Selbstzerfleischungs-Partei Deutschlands". Bei so viel Verzagtheit kann einem um die Dauerhaftigkeit der - voraussichtlichen - Koalition angst und bange werden.
Etwas mehr Mut und Selbstvertrauen täte Schulz, Nahles und Co. gut. Und ihren, nur um das Wohl und Wehe der eigenen Partei besorgten Kritikern würde ein Schuss mehr Verantwortung für Deutschland nicht schaden. Wer viele kleine Verbesserungen für die Menschen hinbekommt, statt des ominösen einen "großen Wurfes", macht sich keineswegs zum Zwerg.