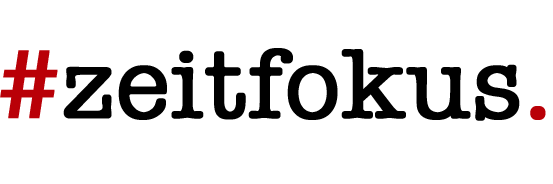Lasst mich in Ruhe!
Im Frühjahr 2024 gibt es ziemlich viel, wogegen man kämpfen sollte. Gegen Hass und Spaltung und Extremismus, zum Beispiel. Die Liste ist in Deutschland gerade ziemlich lang.

Im Frühjahr 2024 gibt es ziemlich viel, wogegen man kämpfen sollte. Gegen Hass und Spaltung und Extremismus, zum Beispiel. Die Liste ist in Deutschland gerade ziemlich lang.
Das ist das eine. Das andere ist: Wer es in diesen Tagen ernst meint mit dem Einsatz für Vernunft und Respekt, der braucht nach Feierabend und am Wochenende nicht noch ein weiteres Kampffeld. Der will Ruhe. Wer diese Ruhe am liebsten im Garten findet - bitteschön. Dafür sind Gärten da.
Das Letzte, was wir deswegen jetzt dort brauchen, ist eine neue Verbotsoffensive. Bitte kein neuer Feldzug gegen die Freiheit, im Garten einfach mal machen zu können, was einem gefällt. Mit anderen Worten: Es gibt vieles, wogegen es sich zu kämpfen lohnt. Siehe oben. Der Kirschlorbeer gehört nicht dazu.
Es gibt echte Probleme. Und es gibt Luxusprobleme. Dass in Deutschlands Gärten nicht alles ökologisch und ästhetisch perfekt läuft, ist ein Luxusproblem. Zu viel Kirschlorbeer, zu wenig Blumenwiese? Zu viele Waschbetonplatten und öde Kieselstein-Vorgärten? Zu viel Outdoorplastik, zu wenige Totholzhaufen? Ja, stimmt alles.
Aber wer jetzt auf den Gedanken kommt, es zu machen wie die Schweiz, die den Kirschlorbeer verbietet, weil er eine ökologische Nullnummer ist, übertreibt es mit der Regulierungslust. Es ist ja auch nicht so, als gehe es in den Gärten der Deutschen zu wie im Wilden Westen. Jeder Gartenbesitzer, jeder Schrebergärtner, jedes Mitglied eines hippen Urban-Gardening-Kollektivs weiß das. Wer nach dem 1. März seine Hecke radikal abschneidet, verstößt gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Wer die falschen Pestizide einsetzt, macht sich strafbar. Wer die Abstandsregeln zum Nachbarn nicht einhält, kann richtig Ärger bekommen. Nur mal so als Beispiel. Nur mal so als Erinnerung daran, dass es schon unüberschaubar viele Regeln gibt und am Ende ja auch so etwas wie Eigenverantwortung.
Zum Beispiel beim Wasserverbrauch: Vor zehn Jahren liefen in trockenen Sommern noch überall die Rasensprenger, idiotischerweise oft in der prallen Mittagssonne. Das ändert sich gerade: aus Einsicht, aus sozialem Druck, aus Kostengründen. Das alles geht manchem vielleicht nicht schnell genug, aber die Richtung stimmt. Der Kulturwandel ist im Gange. Daraus einen Kampf zu machen, ist in diesen Zeiten riskant. Warum ohne Not aus dem Garten ein weiteres Wutthema machen? Wir müssen die Welt schon jeden Tag an der Fleischtheke, im Heizungskeller und an der Tanksäule retten. Und das ist auch gut so. Im Garten dagegen darf die Welt gerne mal was zurückgeben.
Und das tut sie auch. Wenn man der britischen Psychiaterin Sue Stuart-Smith glauben will, die unzählige Studien dazu ausgewertet hat, gibt es praktisch kein einziges menschliches Leid, das sich im Garten nicht wenigstens lindern ließe. Wer in der Erde wühlt, wer pflanzt und erntet, tut sich nachweisbar etwas Gutes. Dass gerade in der Pandemie die Lust der Deutschen auf einen Garten rasant anstieg, hat just damit zu tun.
Gärten, und seien es nur ein paar Quadratmeter auf dem Balkon, sind Fluchtorte in einer zunehmend anstrengenden Welt. Gärten sind analog, langsam, organisch. Das Kontrastprogramm zum digitalen, rasanten, oft schon virtuellen Alltag. Wer diese Inseln zum Auftanken ohne Not noch enger ins Korsett von Regeln und Verboten zwängen will, drängt vielleicht den Kirschlorbeer zurück, macht aber sonst viel kaputt.